Das Wichtigste in 30 Sekunden
- Unsere Bußgeldkataloge: Im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog sind Sanktionen wie Regelbußen, Punkte in Flensburg und Fahrverbote für sämtliche Verkehrsordnungswidrigkeiten zusammengefasst. Bei uns finden Sie die einzelnen Bußgeldkataloge thematisch sortiert nach Verstößen etwa gegen Geschwindigkeitsbeschränkungen, Abstandsregelungen oder Vorgaben zu Drogen und Alkohol am Steuer.
- Verjährung von Ordnungswidrigkeiten: Ordnungswidrigkeiten unterliegen ebenso wie Straftaten der Verjährung. Wie lang die Verjährungsfrist ist, hängt dabei vor allem von der Strafandrohung ab. In der Regel liegt die Verjährungsfrist bei Ordnungswidrigkeiten bei drei Monaten.
- Bescheid prüfen lassen: Rund jeder zehnte Bußgeldbescheid ist fehlerhaft und hätte so nicht ergangen werden dürfen. Wann ein Einspruch sich lohnen und wie ein erfahrener Rechtsanwalt Ihnen dabei helfen kann, erfahren Sie ebenfalls auf bussgeldkataloge.de.
- Einspruchsfrist beträgt zwei Wochen: Nachdem Sie einen Bußgeldbescheid erhalten haben, müssen Sie schnell aktiv werden: Legen Sie nicht innerhalb von 14 Tagen Einspruch ein, entfaltet der Bußgeldbescheid Rechtskraft.
- Anspruch auf Rohmessdaten: Wurden Sie von einem Blitzer abgelichtet, der Rohmessdaten speichert, so haben Sie als Beschuldigter im Bußgeldverfahren einen Anspruch auf Einsicht in die Rohmessdaten.
- Maximal drei Monate Fahrverbot: Spricht die Straßenverkehrsbehörde Ihnen gegenüber ein Fahrverbot aus, so darf es höchstens drei Monate lang gelten. Längere Fahrverbote sind nur bei Verkehrsstraftaten zulässig.
- Führerschein regelmäßig erneuern: Seit dem 19. Januar 2013 müssen alle Autofahrer in Deutschland, die im Besitz eines neuen EU-Führerscheins sind, diesen alle 15 Jahre erneuern lassen. Ältere Führerscheine müssen bis spätestens zum 18. Januar 2033 umgetauscht werden.
Welche Sanktionen erwarten Verkehrssünder in Deutschland?
Herzlich Willkommen auf Bussgeldkataloge.de! Bei uns finden Sie ausführliche Informationen zum Verkehrsrecht, wie zahlreiche Auszüge aus dem aktuellen Bußgeldkatalog 2024 für Pkw-, Lkw-, Bus- und Fahrradfahrer z. B. zu Geschwindigkeit, Abstand, Rote Ampel, Parken & Halten u. v. m. In unserem Bußgeldrechner können Sie sich außerdem alle Bußgelder, Punkte und Fahrverbote für Verkehrsverstöße komfortabel anzeigen lassen.
Die wichtigsten Bußgeldkataloge 2024 auf einen Blick:
Nutzen Sie auch unseren Bußgeldrechner!

Alle wichtigen, im aktuellen Bußgeldkatalog aufgeführten Sanktionen berücksichtigt auch unser Bußgeldrechner. Wollen Sie sich nach einer begangenen Ordnungswidrigkeit auf den bald kommenden Bußgeldbescheid mental vorbereiten und schon einmal die Sanktionen abschätzen, können Sie hierzu unseren Rechner nutzen.
Wählen Sie zunächst im oben stehenden Rechner einfach die entsprechende Kategorie aus, in der sich die von Ihnen begangene Ordnungswidrigkeit bewegt (Geschwindigkeit, Alkohol, Abstand, Ladung usf.). Hiernach können Sie weitere Angaben machen: Wie schnell fuhren Sie? Wie hoch war die Geschwindigkeitsbegrenzung? Das wievielte Mal sind Sie unter Alkoholeinfluss beim Fahren erwischt worden? Befinden Sie sich noch in der Probezeit? Fuhren Sie mit einem Pkw oder Lkw? Innerorts oder außerorts? u. v. m.
Der Rechner bezieht alle von Ihnen getroffenen Angaben ein und ermittelt anschließend, welche Sanktionen laut Bußgeldkatalog (BKat) 2024 für den jeweiligen Verstoß drohen.
Weitere relevante Themen zum aktuellen Bußgeldkatalog
Video: Die wichtigsten Infos zum Bußgeldkatalog
Grundsatz des Verkehrsrechts
Der wichtigsten Regel im Verkehrsrecht, die für alle Verkehrsteilnehmer auf den Straßen ein Mindestmaß an Sicherheit herstellen soll, widmet sich die Straßenverkehrsordnung (StVO) gleich zu Beginn. In § 1 Absatz 1 StVO heißt es:
„Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme.“
Alle im Verkehrsrecht gebotenen Vorschriften basieren auf diesem Grundsatz. Doch nicht jeder Verkehrsteilnehmer hält sich immer an diese Vorgaben. Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr, Stress und Zeitdruck können dann zu dem ein oder anderen Verstoß führen.
Um die Menschen auf das fehlerhafte Verhalten hinzuweisen und als Erziehungsmaßnahme, greifen die Behörden auf zahlreiche Sanktionen zurück. Im aktuellen Bußgeldkatalog 2024 ist aufgelistet, welcher Verstoß welche Folgen für den Verkehrssünder mit sich bringt. Dies sind neben Bußgeldern vor allem auch Punkte in Flensburg und Fahrverbote.
Rechtliche Grundlagen vom Flensburger Bußgeld- und Punktekatalog

Der Bußgeldkatalog (kurz: BKat) wird regelmäßig an die veränderten rechtlichen Bestimmungen angepasst. Er umfasst kurz und bündig alle theoretisch möglichen Verstöße gegen das geltende Verkehrsrecht und ordnet entsprechende Sanktionen zu. Doch welches sind eigentlich die Grundlagen, auf denen der Bußgeldkatalog 2024 basiert?
Allen voran steht dabei die Straßenverkehrsordnung, die das Verhalten im Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer – vom Kraftfahrzeugführer über den Radler bis hin zum Fußgänger – reguliert. Wichtige Vorschriften sind zum Beispiel die Vorfahrtsregeln, das Verhalten an Lichtzeichenanlagen (Ampeln) und Fußgängerüberwegen und Vorgaben zu Geschwindigkeitsbeschränkungen.
Neben diesen maßgeblichen Vorschriften finden sich auch weitere wichtige rechtliche Grundlagen, die für den Bußgeldkatalog 2024 von Bedeutung sind:
- Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO): Sie beschäftigt sich vor allem mit der technischen Beschaffenheit der am Verkehr teilnehmenden Fahrzeuge – auch hier nicht nur auf Kfz beschränkt. Grundlegend dürfen nur verkehrssichere Gefährte auf öffentlichen Straßen und Wege. Welchen Vorgaben Fahrzeuge hierfür genügen müssen, bestimmt die StVZO in allen Einzelheiten – von der Beleuchtung bis hin zu den Fahrzeugabmessungen.
- Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV): In dieser Verordnung ist festgehalten, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Form Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden können. Auch aus den hier gebotenen Bestimmungen ergibt sich die ein oder andere Verkehrsordnungswidrigkeit, die im Bußgeldkatalog aufgeführt ist (z. B. das Fahren ohne Betriebserlaubnis).
- Fahrerlaubnisverordnung (FeV): Hier wird bestimmt, welche Voraussetzungen die Fahrzeugführer selbst erfüllen müssen, um überhaupt erst eine Fahrerlaubnis zu erhalten und welche Vorgaben für die einzelnen Führerscheinklassen gelten.
- Straßenverkehrsgesetz (StVG): In diesem Gesetz sind teils ordnungswidrige, teils strafrechtlich relevante Regelungen für Verkehrsteilnehmer. Wichtige Vorgaben, die auch im Bußgeldkatalog 2024 eine große Rolle spielen, sind die Bestimmungen zum Fahren unter Alkoholeinfluss sowie zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch die zusätzlichen Sanktionen bei einem Verstoß in der Probezeit, die jeder Führerscheinneuling durchläuft, sind durch das StVG reguliert.
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG): Dieses Gesetz bildet die Grundlage für die Erhebung von Bußgeldern und die Festsetzung weiterer Sanktionen – etwa auch bei Tatmehrheit oder Tateinheit.
- Bußgeldkatalogverordnung (BKatV): Diese Verordnung reguliert den Bußgeldkatalog selbst. Sie bestimmt unter anderem wann Abweichungen von den festgesetzten Bußgeldern möglich sind und welche Sanktion für welchen Verstoß droht. Der Tatbestandskatalog, den das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) herausgibt, bildet eine entsprechende Ergänzung und soll vor allem den Behörden wesentliche Vereinfachung verschaffen.
Welche Verstöße umfasst der aktuelle Bußgeldkatalog 2024?
Regeln funktionieren nur, wenn Verstöße gegen diese auch Konsequenzen nach sich ziehen. Entsprechend der in den obigen Verordnungen und Gesetzen aufgestellten Vorschriften, finden sich im Bußgeldkatalog zu den jeweiligen Verstößen Angaben zum erwartbaren Bußgeld, der Anzahl der Punkte in Flensburg sowie ein ggf. drohendes Fahrverbot.
Die wichtigsten Kategorien im Bußgeld- und Punktekatalog aus Flensburg sind:

- Alkohol- und Drogenverstöße im Straßenverkehr
- Geschwindigkeitsverstöße
- Abstandsverstöße
- Vorfahrtsverstöße
- Rotlichtverstöße
- Überholverstöße
- Park- und Halteverstöße
- Verstöße gegen die Vorschriften zum Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren
Auf unserer Plattform stellen wir Ihnen entsprechend der Kategorien jeweils eine spezifische Bußgeldtabelle zur Verfügung. Darüber hinaus finden Sie zu den wichtigsten Verstößen auch entsprechender Bußgeldrechner, mit deren Hilfe Sie einen ersten Eindruck von den zu erwartenden Sanktionen erhalten können.
Wie hoch sind die Bußgelder laut Bußgeldkatalog 2024?
Eine pauschale Aussage zur Höhe von einem verhängten Bußgeld kann nicht getroffen werden. Die Bandbreite reicht von wenigen Euro etwa für einen Parkverstoß bis hin zu mehreren hundert Euro. So kann Sie das Überqueren eines Bahnübergangs bei geschlossener (Halb-)Schranke mit einem Kraftfahrzeug zum Beispiel laut Bußgeldkatalog 700 Euro kosten.
Weit höhere Bußgelder sind etwa möglich, wenn Sie wiederholt gegen die 0,5-Promillegrenze verstießen. Liegt das Bußgeld bei einem erstmaligen Verstoß noch bei 500 Euro, steigt dies beim zweiten und dritten Mal jeweils um weitere 500 Euro an.
Bei Geldbußen bis 55 Euro kann die Behörde im Zweifel auch eine Verwarnung aussprechen – ein Angebot, das gerade bei Parkverstößen die Regel ist. Die Gebühren und Auslagen fallen dann nicht an. Nehmen Sie die Verwarnung nicht an und zahlen das verhängte Verwarnungsgeld nicht, wird ebenfalls ein Bußgeldverfahren eröffnet.
Wie viele Punkte drohen laut Katalog bei einem Verstoß?

Der vom KBA in Flensburg errichtete Bußgeld- & Punktekatalog enthält, wie bereits zuvor angemerkt, auch Angaben zu den im Falle eines Verstoßes anzusetzenden Punkteeintragungen im Fahreignungsregister (FAER).
Zum 1. Mai 2014 wurde das Punktesystem in Deutschland maßgeblich überarbeitet. Seit diesem Zeitpunkt genügen bereits acht – und nicht mehr wie zuvor 18 Punkte – für den Fahrerlaubnisentzug. Allerdings wurde mit der Punktereform einhergehend auch die Anzahl der zu erteilenden Punkte je Verstoß reduziert.
Seit der Reform des Punktesystems kann das KBA für einen im Bußgeldkatalog aufgeführten Verstoß nur noch maximal drei Punkte verhängen. Aber wann drohen laut Bußgeldkatalog wie viele Punkte? Dies richtet sich maßgeblich nach der Schwere des Verstoßes, wie Sie der folgenden Punktetabelle entnehmen können:
| Ausmaß des Verstoßes | Punkte in Flensburg |
|---|---|
| einfache Ordnungswidrigkeit | 0 |
| verkehrsgefährdende und beeinträchtigende Ordnungswidrigkeiten | 1 |
| Ordnungswidrigkeit mit verhängtem Fahrverbot oder Straftat ohne Fahrerlaubnisentzug | 2 |
| Straftat mit Entziehung der Fahrerlaubnis | 3 |
Als einfache Ordnungswidrigkeiten können zum Beispiel Parkverstöße gelten oder aber geringfügige Geschwindigkeitsüberschreitungen bis einschließlich 20 km/h. Schwerwiegendere Verkehrsordnungswidrigkeiten sind laut Bußgeldkatalog 2024 etwa Geschwindigkeitsüberschreitungen ab 21 km/h oder aber Verstöße gegen die Vorfahrtsregeln. Für diese Tatbestände droht regelmäßig die Verhängung von einem Punkt.
Geschwindigkeitsüberschreitungen ab 41 km/h außerorts bzw. ab 31 km/h innerorts sind als verkehrsgefährdend einzustufen und führen regelmäßig zur Verhängung von einem mindestens einmonatigen Fahrverbot. Ähnlich verhält es sich etwa auch bei einem Alkoholverstoß (ohne besondere Gefährdung). Hierfür drohen laut Bußgeldkatalog in jedem Fall zwei Punkte in Flensburg.
Drei Punkte in Flensburg drohen laut Bußgeldkatalog zum Beispiel bei folgenden Straftaten:

- Verkehrsgefährdung durch Fahren unter Alkoholeinfluss
- Fahren bei einem Promillewert ab 1,1
- fahrlässige Körperverletzung oder Tötung (etwa bei einem Unfall)
- Fahrerflucht
- unterlassene Hilfeleistung
- Überqueren eines Bahnübergangs bei geschlossener Schranke
- Fahren ohne Fahrerlaubnis (etwa auch während eines vollstreckten Fahrverbots)
Ob Sie nach einem Verstoß die Verhängung von Punkten befürchten müssen und wie viele Eintragungen Sie im Einzelfall erhalten, können Sie anhand unseres Bußgeldrechners einschätzen lassen. Er kann zusätzlich als Punkterechner die in Flensburg zu erwartenden Eintragungen im FAER ermitteln. Beachten Sie dabei jedoch, dass die Behörden und Gerichte im Einzelfall auch von den Vorgaben im Bußgeldkatalog 2024 abweichen können. Es handelt sich also nur um Richtwerte.
Welche Auswirkungen haben Punkte in Flensburg?
Sammeln Verkehrsteilnehmer viele Punkte in Flensburg, hat dies natürlich Konsequenzen. Da diese bei verkehrsgefährdenden und beeinträchtigenden Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen werden, deutet ein hoher Punktestand auf beharrliche Regelmissachtungen hin.
Dies bleibt natürlich auch dem KBA nicht verborgen, sodass unterschiedliche Schritte eingeleitet werden, wenn Kfz-Fahrer sich häufig schwerwiegende Ordnungswidrigkeiten leisten. Dabei werden folgende „Sanktionen“ je Punktestand fällig:
- Bis zu drei Punkte: Der Fahrer wird zwar vorgemerkt, Konsequenzen drohen bei diesem Punktestand allerdings noch nicht.
- Vier oder fünf Punkte: In diesem Fall erhält der Betroffene eine kostenpflichtige schriftliche Ermahnung. Das KBA weist zudem darauf hin, dass eine freiwillige Teilnahme an einem Fahreignungsseminar, durch welche ein Punkt abgebaut werden kann, sinnvoll erscheint.
- Sechs oder sieben Punkte: Ab diesem Punktestand wird es kritisch. Der Betroffene erhält eine kostenpflichtige Verwarnung. Der Punkteabbau ist nicht mehr möglich, sobald Sie sechs Punkte auf dem Konto haben.
- Acht Punkte: Ist der Maximalpunktestand in Flensburg erreicht, wird die Fahrerlaubnis entzogen. Damit geht meist eine Sperrfrist von mindestens sechs Monaten einher. Erst nach diesem Zeitraum kann die Fahrerlaubnis erneut beantragt werden.
Wann verfallen Punkte in Flensburg?

Nicht nur durch die Teilnahme an einem entsprechenden Abbauseminar lässt sich der Punktestand in Flensburg verringern. Punkte werden nicht für die Ewigkeit gespeichert, sie verfallen nach einem bestimmten Zeitraum.
Dabei ist entscheidend, wie viele Punkte der Verkehrssünder für die jeweilige Ordnungswidrigkeit erhalten hat. Der Verfall staffelt sich wie folgt:
- Ein Punkt verfällt nach zwei ein halb Jahren
- Zwei Punkte verfallen nach fünf Jahren
- Drei Punkte verfallen nach zehn Jahren
Wie lang dauert das Fahrverbot laut Bußgeldkatalog 2024?
Neben Bußgeld und Punkten führt der BKat auch noch eine weitere Sanktion auf, die im Falle einiger schwerwiegender Verstöße droht: das Fahrverbot. Anders als beim Führerscheinentzug, bei dem der Betroffene seine Fahrerlaubnis dauerhaft abgeben muss – für mindestens sechs Monate – handelt es sich beim Fahrverbot um eine zeitlich stark begrenztes Verbot, Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr zu führen.
Grundsätzlich kann auch im Einzelfall bei Verkehrsstraftaten von einem Führerscheinentzug abgesehen werden. Alternativ haben die Gerichte hierbei die Möglichkeit, ein zeitlich begrenztes Fahrverbot festzusetzen.

Ein dreimonatiges Fahrverbot droht zum Beispiel bei Geschwindigkeitsüberschreitungen über 70 km/h außerorts bzw. ab 61 km/h innerorts sowie einem wiederholten Alkoholverstoß.
Zwei Monate Fahrverbot sieht der Bußgeldkatalog 2024 in Deutschland für Geschwindigkeitsübertretungen ab 61 km/h außerorts bzw. ab 31 km/h innerorts vor.
Ein erstmaliger Alkoholverstoß und Geschwindigkeitsüberschreitungen ab 21 km/h können zu einem einmonatigen Fahrverbot führen.
Blitzer und Radarfallen überführen Verkehrssünder
Bevor die Sanktionen gemäß Bußgeldkatalog überhaupt vollstreckt werden können, muss eine entsprechende Ordnungswidrigkeit erst einmal aufgedeckt werden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch die Polizei ist dies zum Beispiel möglich.
Parkverstöße werden in aller Regel durch Mitarbeiter des Ordnungsamts aufgedeckt, wenn diese beispielsweise kontrollieren, ob die Parkgebühr in einer Zone mit Parkraumbewirtschaftung bezahlt wurde oder nicht.
Um Tempo-, Abstands- und Rotlichtverstöße aufzudecken, werden häufig Blitzer und Radarfallen genutzt. Diese kommen sowohl mobil als auch stationär zum Einsatz. Dabei kommen ganz unterschiedliche Messtechniken zum Einsatz.
Sogenannte Ampelblitzer sind in aller Regel stationär. Eine Induktionsschleife wird unter der Fahrbahn verbaut. Diese reicht etwa vom Ampelmast bis hin zur Haltelinie. Fährt ein Verkehrsteilnehmer nun bei „Rot“ über die Haltelinie, löst eine Kamera aus.
Allerdings handelt es sich hierbei noch nicht um einen Rotlichtverstoß. Dieser ist erst gegeben, wenn der Kfz-Fahrer weiterfährt. Um zu beweisen, dass eine rote Ampel überfahren wurde, wird ein weiteres Blitzerfoto angefertigt.
Blitzer messen nicht immer fehlerfrei

Zwar sind Blitzer und Radarfallen die Hauptlieferanten für Beweismittel, welche dazu führen können, dass die Sanktionen gemäß Bußgeldkatalog 2024 vollstreckt werden, allerdings liefern diese nicht immer korrekte Messergebnisse.
Dabei lassen sich einige Fehlerquellen ausfindig machen, die häufiger auftreten. Diese stellen wir Ihnen im Folgenden kurz vor:
- Der Blitzer wurde falsch aufgestellt, sodass der Messbereich nicht eindeutig definiert war.
- Das Messprotokoll weist Unregelmäßigkeiten auf.
- Das Personal, welcher die Radarfalle bedient hat, hatte nicht die ausreichende Qualifikation für die Geschwindigkeitsmessung.
- Das Gerät wurde nicht vorschriftsgemäß geeicht.
- Straßenschäden haben die korrekte Messung behindert und somit das Messergebnis verfälscht.
- Mehrere Fahrzeuge befanden sich gleichzeitig im Messbereich, sodass eine eindeutige Zuteilung der Messung nicht möglich war.
Wie ein Bußgeldverfahren abläuft
Haben Blitzer beispielsweise einen Tempoverstoß festgestellt, muss zunächst einmal der Halter des Fahrzeugs, mit welchem die Ordnungswidrigkeit begangen wurde, ermittelt werden. Zu diesem Zweck führt die zuständige Behörde eine Datenabfrage beim KBA durch, welches sämtliche Halterdaten von Fahrzeugen, die in Deutschland zugelassen sind, gespeichert hat.
Ist der Halter identifiziert, erhält dieser im ersten Schritt einen Anhörungs- oder Zeugenfragebogen. Letzterer wird versendet, wenn der Halter eindeutig nicht der Fahrer gewesen sein kann (Beispiel: Das Fahrzeug ist auf Herrn Hase zugelassen, auf dem Blitzerfoto ist allerdings eindeutig erkennbar, dass eine Frau den Wagen zum Tatzeitpunkt gefahren hat).
Handelt es sich beim Halter auch um den Fahrer, kann dieser auf dem Anhörungsbogen Angaben zur Ordnungswidrigkeit machen. Diese sind allerdings nicht verpflichtend. Im nächsten Schritt des Bußgeldverfahrens verschickt die Bußgeldstelle einen Bußgeldbescheid.
Dieses Schreiben führt die Sanktionen auf, welche gemäß Bußgeldkatalog für die begangene Ordnungswidrigkeit ausgesprochen werden. Zudem befindet sich auf dem Bußgeldbescheid der Hinweis, dass dieser binnen 14 Tagen die Rechtskraft erlangt, sofern Betroffene keinen Einspruch einlegen.
Wird das Bußgeld bezahlt, gilt das Bußgeldverfahren als abgeschlossen. Legen Beschuldigte allerdings einen Einspruch gegen den Bußgeldbescheid und die veranschlagten Sanktionen gemäß Bußgeldkatalog 2024 ein, wird der Fall erneut überprüft. Dazu erfahren Sie im weiteren Textverlauf mehr.
Kein Bußgeldverfahren bei einem Verwarnungsgeld
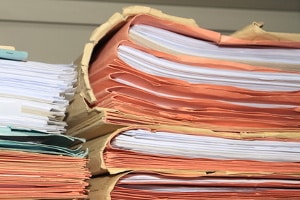
Nicht jede Ordnungswidrigkeit wird automatisch mit einem Bußgeld gemäß Bußgeldkatalog geahndet. Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten, wie beispielsweise dem Überschreiten der Parkzeit, kann auch eine Verwarnung inklusive Verwarnungsgeld ausgesprochen werden.
Das bekannte Knöllchen wird meist unter den Scheibenwischer geklemmt. Bezahlen Parksünder das Verwarnungsgeld innerhalb von sieben Tagen, können Sie die Einleitung von einem Bußgeldverfahren abwenden.
Dies hat den Vorteil, dass die Gebühren gespart werden. Diese werden nämlich gemäß § 107 Absatz 1 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) in jedem Verfahren einer Verwaltungsbehörde erhoben:
Im Verfahren der Verwaltungsbehörde bemißt sich die Gebühr nach der Geldbuße, die gegen den Betroffenen im Bußgeldbescheid festgesetzt ist. Wird gegen eine juristische Person oder eine Personenvereinigung eine Geldbuße nach § 30 festgesetzt, so ist von der juristischen Person oder der Personenvereinigung eine Gebühr zu erheben, die sich nach der gegen sie festgesetzten Geldbuße bemißt. Als Gebühr werden bei der Festsetzung einer Geldbuße fünf vom Hundert des Betrages der festgesetzten Geldbuße erhoben, jedoch mindestens 25 Euro und höchstens 7 500 Euro.
Die Gebühren betragen also mindestens 25 Euro. Zusätzlich wird eine Versandpauschale in Höhe von 3,50 Euro für das Versenden des Bußgeldbescheids erhoben. Wer also das Verwarnungsgeld bezahlt, kann eine Menge Geld sparen.
Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegen

Nicht selten kommt es vor, dass ein Bußgeldbescheid ganz unverhofft im eigenen Briefkasten landet. Viele Betroffene sind sich zunächst einmal keiner Schuld bewusst, andere Kfz-Fahrer haben den Blitz der Radarfalle schon gesehen und sich auf die Sanktionen gemäß Bußgeldkatalog eingestellt.
In jedem Fall sollten Sie aber immer hinterfragen, ob Sie die Ihnen vorgeworfene Ordnungswidrigkeit auch tatsächlich begangen haben können. Denn auch in der Bußgeldstelle arbeiten nur Menschen und diesen können Fehler unterlaufen – von den Messungenauigkeiten der Blitzer ganz abgesehen.
Halten Sie die Sanktionen gemäß Bußgeldkatalog 2024 für ungerechtfertigt, haben Sie die Möglichkeit, Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einzulegen. Dabei ist unbedingt die in § 67 Absatz 1 OWiG definierte Frist zu wahren:
Der Betroffene kann gegen den Bußgeldbescheid innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsbehörde, die den Bußgeldbescheid erlassen hat, Einspruch einlegen. […]
Sie haben also maximal zwei Wochen Zeit, ein entsprechendes Schreiben aufzusetzen und der Bußgeldstelle postalisch zu übermitteln. Halten Sie die Frist nicht ein, wird der Bußgeldbescheid rechtskräftig und ein Einspruch ist nicht mehr möglich.
Wann tritt die Verjährung vom Bußgeldbescheid ein?
Doch nicht nur Messungenauigkeiten können dazu führen, dass ein Bußgeldbescheid ungültig wird. In Deutschland gilt bei Ordnungswidrigkeiten das Prinzip der Verjährung. Dies ist in § 26 Absatz 3 Straßenverkehrsgesetz (StVG) geregelt:
Die Frist der Verfolgungsverjährung beträgt bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 drei Monate, solange wegen der Handlung weder ein Bußgeldbescheid ergangen noch öffentliche Klage erhoben ist, danach sechs Monate.
Erhalten Sie einen Bußgeldbescheid also mehr als drei Monate nachdem die Ordnungswidrigkeit begangen wurde, können die Sanktionen gemäß Bußgeldkatalog nicht mehr vollstreckt werden. Allerdings müssen Sie auch in diesem Fall unbedingt einen Einspruch einlegen.
Handy am Steuer: Sanktionen gemäß Bußgeldkatalog 2024

Das Smartphone wird immer wichtiger. Viele Menschen teilen Momente aus ihrem Leben in den sozialen Medien. Einige schrecken nicht einmal davor zurück, während der Autofahrt Textnachrichten zu tippen oder Selfies zu versenden.
Dies stellt natürlich ein erhebliches Risiko für die Verkehrssicherheit dar, da Autofahrer unweigerlich abgelenkt werden, während sie das Handy am Steuer benutzen. Dieser Umstand ist auch dem Gesetzgeber nicht verborgen geblieben, sodass zum 19.10.2017 die Sanktionen gemäß Bußgeldkatalog für die Handynutzung am Steuer angepasst wurden.
Gab es vor der Gesetzesänderung für diese Ordnungswidrigkeit noch ein Bußgeld von 60 Euro sowie einen Punkt in Flensburg, beträgt die Geldbuße nunmehr 100 Euro. Werden andere Teilnehmer im Zuge der Handynutzung am Steuer gefährdet, steigt das Bußgeld auf 150 Euro. Zusätzlich gibt es zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.
Allerdings ist die Nutzung von einem Mobiltelefon am Steuer nicht grundsätzlich verboten. Ist eine Freisprecheinrichtung vorhanden, darf diese auch genutzt werden. § 23 Absatz 1a StVO definiert diesbezüglich folgendes:
Wer ein Fahrzeug führt, darf ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist, nur benutzen, wenn
- hierfür das Gerät weder aufgenommen noch gehalten wird und
- entweder
a) nur eine Sprachsteuerung und Vorlesefunktion genutzt wird oder
b) zur Bedienung und Nutzung des Gerätes nur eine kurze, den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- undWetterverhältnissen angepasste Blickzuwendung zum Gerät bei gleichzeitig entsprechender Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen erfolgt oder erforderlich ist.
Geräte im Sinne des Satzes 1 sind auch Geräte der Unterhaltungselektronik oder Geräte zur Ortsbestimmung, insbesondere Mobiltelefone oder Autotelefone […]
Die Smartphonesucht hält nicht nur bei Kfz-Fahrern ein. Auch Fußgänger können den Blick oft nicht vom Mobiltelefon lassen und gefährden dadurch vor allem sich selbst. Während diese aber nicht dafür sanktioniert werden können, sieht der Bußgeldkatalog für Radfahrer ein Bußgeld von 55 Euro vor, wenn diese das Handy während der Fahrt nutzen.
Anpassungen vom Bußgeldkatalog

Nicht nur für die Nutzung von einem Handy am Steuer wurden die Bußgelder angehoben. Auch weitere Ordnungswidrigkeiten werden seit Ende 2017 härter bestraft als zuvor. So gibt es für das Veranstalten von bzw. die Teilnahme an illegalen Autorennen nun drei Punkte in Flensburg.
Es handelt sich zudem um eine Straftat. Eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe sind möglich. Zudem wird dem Betroffenen die Fahrerlaubnis entzogen. Kommen Personen durch das illegale Autorennen zu Schaden, ist eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren möglich.
Immer wieder häufen sich Meldungen über Verkehrsteilnehmer, die nach einem Unfall keine Rettungsgasse gebildet und somit die Einsatzkräfte wesentlich behindert haben. Aus diesem Grund wurden auch hierfür die Sanktionen gemäß Bußgeldkatalog angepasst.
Wer auf der keine freie Gasse für die Durchfahrt von Einsatzkräften bei stockendem Verkehr nach einem Unfall bildet, muss mit einem Bußgeld von 200 Euro sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen. Werden Rettungskräfte zusätzlich behindert, erhöht sich das Bußgeld auf 240 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat gibt es obendrauf.
Die Bildung einer Rettungsgasse ist grundsätzlich nur außerhalb geschlossener Ortschaften vorgeschrieben. Selbstverständlich müssen Verkehrsteilnehmer allerdings auch innerorts Einsatzfahrzeugen mit blauem Blinklicht und Martinshorn sofort eine freie Bahn verschaffen.
Wer den Einsatzfahrzeugen keine Durchfahrt ermöglicht, muss mit einem Bußgeld von 240 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigem Fahrverbot rechnen.
Zusätzliche Sanktionen für Fahranfänger in der Probezeit
Der Bußgeldkatalog, der von Flensburg aus die Sanktionen im gesamten Bundesgebiet beeinflusst, führt neben den oben aufgelisteten Sanktionen – Bußgelder, Punkte und Fahrverbote – auch zusätzliche für Fahranfänger, die gegen eine der zahlreichen Regeln im Verkehrsrecht verstoßen. Für die Sanktionierung sind die einzelnen Tatbestände in zwei Kategorien eingeordnet: A- und B-Verstöße.
Je nachdem, wie viele A- und B-Verstöße ein Fahrer in seiner Probezeit auf seinem Konto ansammelt, sind zusätzliche Sanktionen wie die Probezeitverlängerung oder die Teilnahme an einem Aufbauseminar vorgesehen. Wichtig ist, dass diese Maßnahmen neben Punkten, Fahrverboten und Bußgeldern verhängt werden – sie ersetzen sie nicht.
Zudem droht ein Führerscheinentzug bei Führerscheinneulingen schon wesentlich schneller als bei den „alten Hasen“. Dieser ist nämlich nicht ausschließlich an das Punktekonto oder eine schwere Straftat gebunden, sondern kann auch schon vorzeitig bei Ansammlung zu vieler A- und B-Verstöße erfolgen.
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wann welche Sanktion – zusätzlich zu den nach Bußgeldkatalog 2024 festzusetzenden Bußgeldern, Fahrverboten oder Punkten – für Fahranfänger drohen können:
| Anzahl der Verstöße | |
|---|---|
| in der regulären Probezeit | |
| erster A-Verstoß | Probezeitverlängerung um zwei weitere Jahre + Aufbauseminar (Pflicht) |
| zweiter B-Verstoß | Probezeitverlängerung um zwei weitere Jahre + Aufbauseminar (Pflicht) |
| in der verlängerten Probezeit | |
| erster A-Verstoß | Verwarnung + Empfehlung zur Teilnahme an einer verkehrspsychologischen Beratung |
| zweiter B-Verstoß | Verwarnung + Empfehlung zur Teilnahme an einer verkehrspsychologischen Beratung |
| zweiter A-Verstoß | Entzug der Fahrerlaubnis für mindestens sechs Monate |
| zwei B-Verstöße + ein A-Verstoß | Entzug der Fahrerlaubnis für mindestens sechs Monate |
| vierter B-Verstoß | Entzug der Fahrerlaubnis für mindestens sechs Monate |





 (112 Bewertungen, Durchschnitt: 3,71 von 5)
(112 Bewertungen, Durchschnitt: 3,71 von 5)